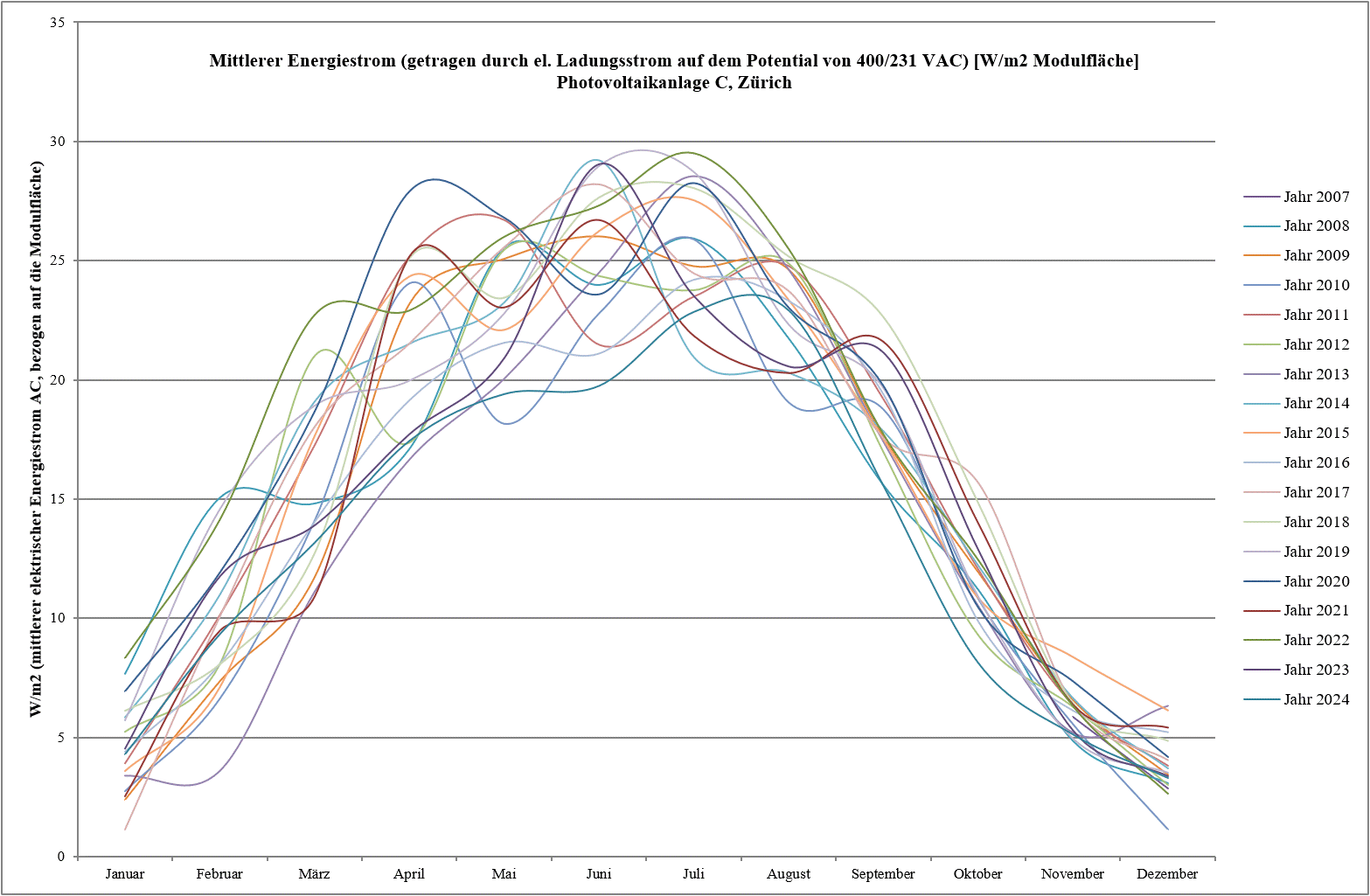Globalstrahlung und Ertragsdaten von Photovoltaikanlagen
Der konstant fliessende Strahlungsenergiestrom der Sonne wird an deren Photosphäre auf einem Temperatur-Potential von ca. 5'800 K emittiert. Die sehr hohe Intensität dieser Strahlung an der Photosphäre von ca. 64'000'000 W/m2 reduziert sich über die Distanz Sonne-Erde quadratisch mit der Entfernung und so ergibt sich über die im Mittel knapp 150 Mio. km beim Auftreffen auf die Atmosphäre unserer Erde der Wert von 1'367 W/m2 (Solarkonstante).
Dieser auf die Erde treffende Strahlungsenergiestrom ist der Antrieb unserer Biosphäre, sowie auch DAS primäre Angebot für den nachhaltigen Antrieb unserer zivilisatorischen Errungenschaften und Prozesse.
Der Wert der Solarkonstante reduziert sich weiter auf einen Viertel, also auf 342 W/m2, wenn der Strahlungs-Energiestrom auf die ganze Atmosphärenoberfläche bezogen wird, also auf das Vierfache der von der Sonne angestrahlten Querschnittsfläche der Erde.
Der auf die Kugeloberfläche bezogene Strahlungsenergiestrom von 342 W/m2 ist demnach der über die Jahreszeiten und Tageszeiten gemittelte Wert des Energiestromes der von der Sonne her an der Erdatmosphären-Oberfläche eintrifft.
Ein Teil davon erreicht direkt oder indirekt, als Globalstrahlung, die Erdoberfläche mit folgender durchschnittlicher Intensität:
- In der Nähe der Pole: < 100 W/m2
- In mittleren Breiten: 100 - 200 W/m2
- Zwischen den Wendekreisen: 200 - 300 W/m2
- In Bern (Zollikofen)*: 131 W/m2
- In Genf (Cointrin)*: 140 W/m2
- In Zürich (Kloten)*: 126 W/m2
* Die von MeteoSchweiz zur Verfügung gestellten Messdaten der Globalstrahlung sind Mittelwerte der Jahre 1981 bis 2000 und variieren über die Jahreszeit wie folgt (Diagramm):
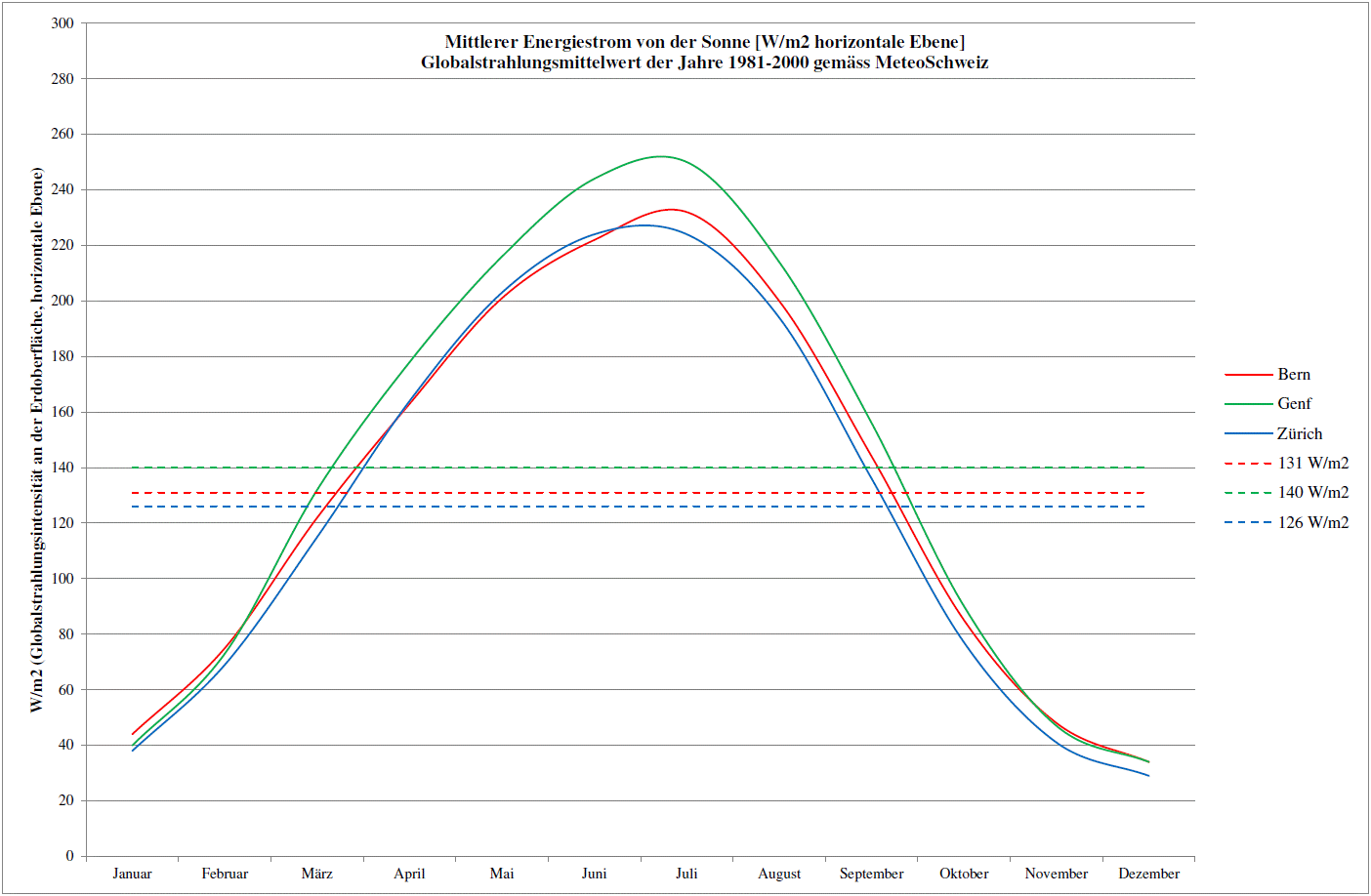
In unseren Breiten können auf einer geneigten Fläche und somit etwa senkrecht einfallender Direktstrahlung bei klarem Wetter Strahlungs-Intensitäten von um die 1'000 W/m2 auftreten.
Höchste Intensitäten des Globalstrahlungsenergiestromes von der Sonne können lokal auf Gebirgen in der Nähe des Äquators (AM < 1.0) durch Reflexionen an Wolken etc. weit über die Solarkonstante hinausgehen. So wurden angeblich in den Anden Ecuadors Intensitäten von über 1'800 W/m2 gemessen.
Der auf die Erdoberfläche eintreffende Energiestrom, getragen durch die Strahlung der Sonne, kann zu einem beträchtlichen Teil mittels des technisch herausragenden Prozesses der Photovoltaik weitgehend verschleissfrei und ohne bewegte oder rotierende Teile direkt auf den elektrischen Ladungsstrom mit zugehörigem Spannungspotential umgeladen werden. Diese «Elektrizität» dient heute schon und in Zukunft voraussichtlich noch viel mehr als Haupt- oder zumindest als Hilfs-Energieträger für den Betrieb aller unserer Prozesse zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung.
Die Nennleistungsangabe P (STC) der Photovoltaikmodule bezieht sich auf Standard-Strahlungs- und Umgebungs-Bedingungen (STC, Standard Test Conditions). Danach beträgt die Intensität des Strahlungs-Energiestromes 1'000 W/m2 und dies bei 1.5-facher Luftmasse (AM 1.5). Eine solche «Norm»-Strahlung kann hier bei uns etwa an klaren Tagen um den Mittag zur Jahreszeit der Tagundnachtgleiche, also bei einer Sonnenhöhe über dem Horizont von ca. 42°, auf einer entsprechend geneigten Ebene eintreffen.
Die nachfolgenden Grafiken geben die langjährigen mittleren Ertragsdaten dreier älterer Photovoltaikanlagen wieder. Es wird der mittlere, auf die Gesamt-Modulfläche bezogene Energiestrom, also die Prozessleistung dargestellt, welche aus der am Anlagenstandort eintreffenden Globalstrahlung verfügbar gemacht wird. Die Prozessleistung ist dabei der Energiestrom, welcher getragen durch das hier übliche elektrische Drehstrom-Versorgungssystem (mit Spannung 3x400/231 V) nutzbar wird.
Die drei Anlagen in Bern, Genf, und Zürich werden «normal» gewartet:
- Fernüberwachung mit Ertragskontrolle
- Periodische Kontrolle vor Ort (Zustand der Module, mechanische Befestigung, Elektroinstallation etc.); ca. alle 2-3 Jahre
- Periodische Reinigung des Solarzellenfeldes; ca. alle 4-6 Jahre
Grössere Störungen und Ausfälle, wie z.B. ein Wechselrichterersatz führen zu Ertragseinbrüchen, ansonsten bewegen sich die langjährigen Schwankungen im Rahmen von ca. +/-10% des langjährigen Mittelwertes. Der Ersatz eines Wechselrichters hat in dieser Zeit der technologischen Weiterentwicklung auch zu einer merkbaren Verbesserung der Gesamteffizienz geführt. Ausserdem gibt es in der dargestellten Zeitspanne generell eine leichte Tendenz zunehmender Globalstrahlung (global brightening?), so dass eigentlich kein Alterungseffekt offensichtlich ist.
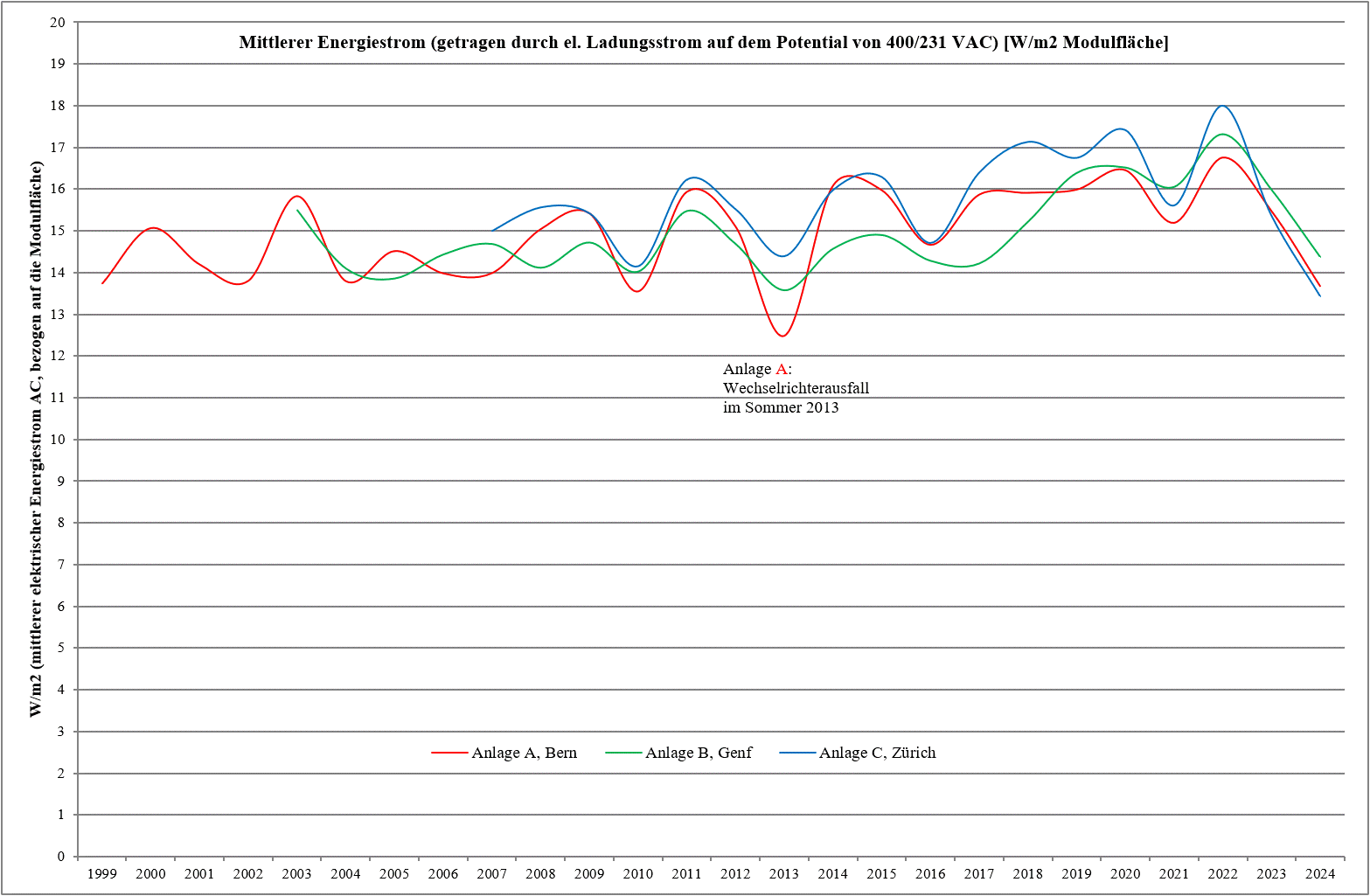
Anlage A, Bern:
- 1998 Baujahr
- 31.7 kW Nennleistung des Solarzellenfeldes, aufgeteilt auf 8 Stränge mit je 33 Modulen à 120 W,
ein Wechselrichter mit Nennleistung 25 kW AC - 245 m2 Gesamt-Modulfläche
- 578 m ü.M., Flachdach-Anlage
- -12° Südabweichung, leicht nach Ost orientiert
- 24° Neigung der Module
- Spezieller Unterhalt/Instandhaltung
Jahr 2013: Wechselrichter wegen Defekt ersetzt
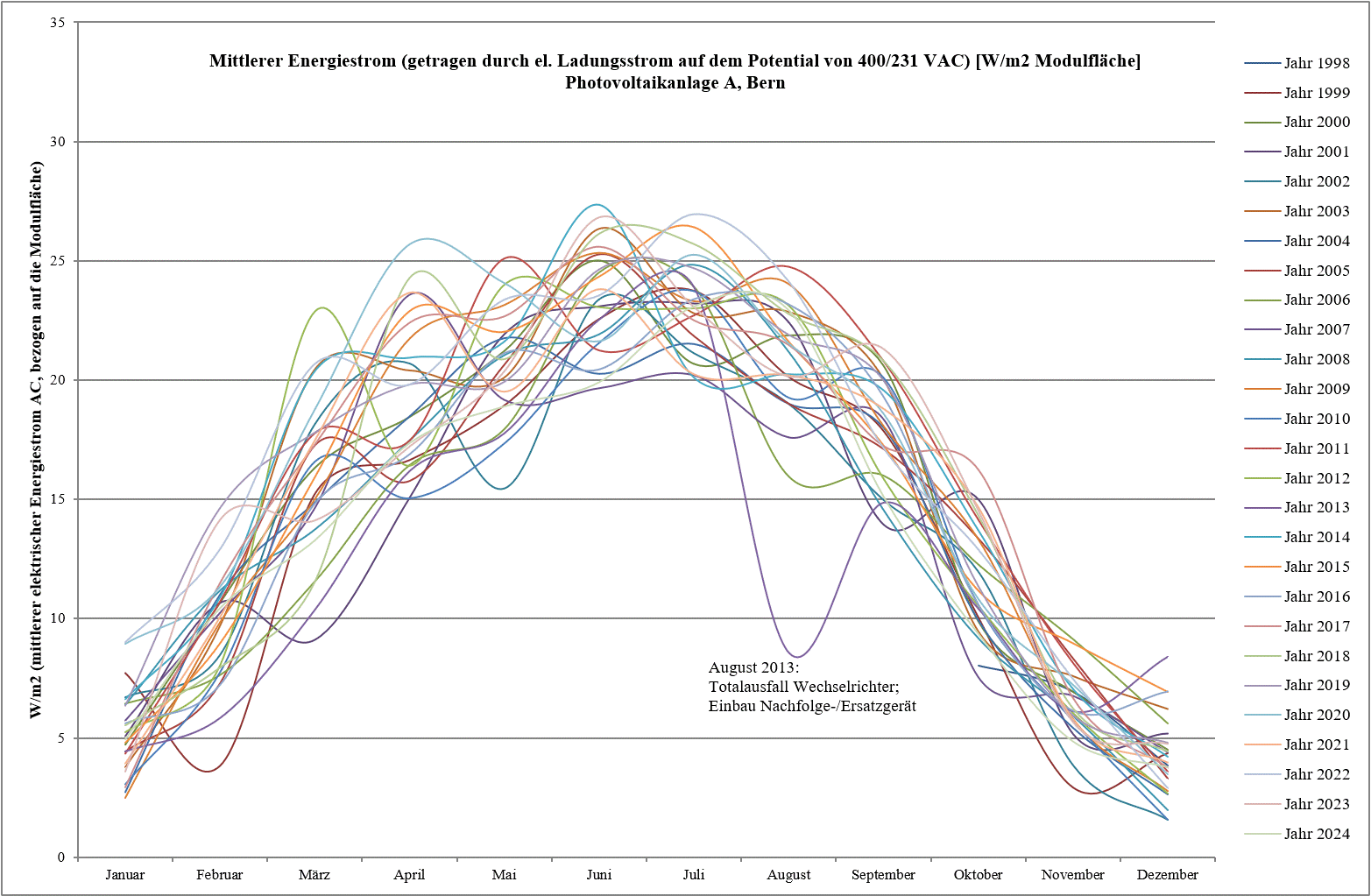
Anlage B, Genf:
- 2002 Baujahr
- 7 kW Nennleistung des Solarzellenfeldes, aufgeteilt auf 8 Stränge mit je 26 Modulen à 167 W, ein Wechselrichter mit Nennleistung 25 kW AC
- 266 m2 Gesamt-Moduläche
- 455 m ü.M., Flachdach-Anlage
- -45° Südabweichung, nach Süd-Ost orientiert
- 10° Neigung der Module
- Spezieller Unterhalt/Instandhaltung
Jahr 2012: 3 Stk. Module wegen Defekt/Beschädigung ersetzt
Jahr 2017/18: Wechselrichter wegen Defekt ersetzt - Rückbau/Abbau der Anlage ab September 2025, zufolge der Kündigung des Dachnutzungsvertrages durch den Gebäudebesitzer
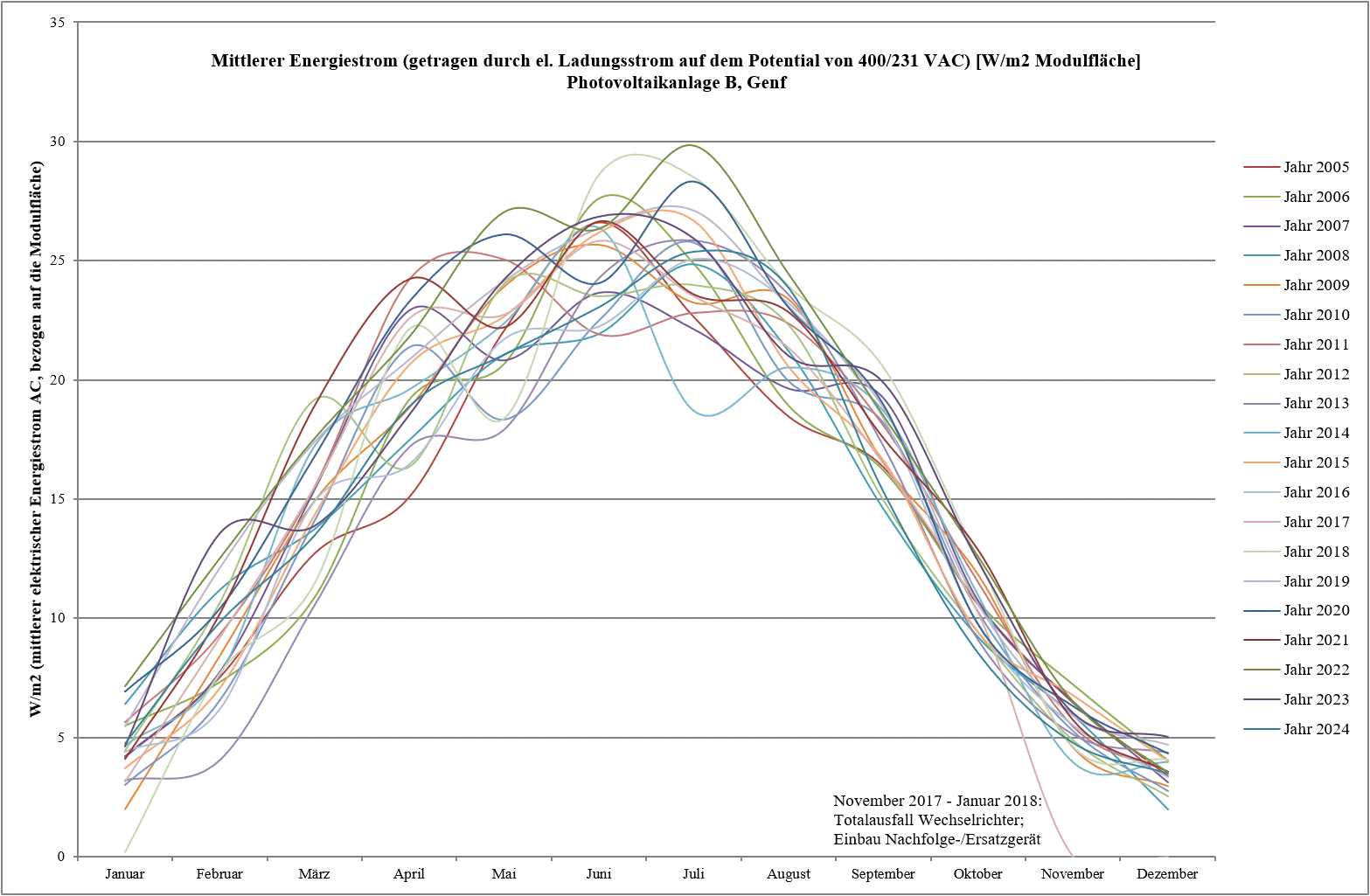
Anlage C, Zürich:
- 2007 Baujahr
- 21.0 kW Nennleistung des Solarzellenfeldes, aufgeteilt auf 8 Stränge mit je 15 Modulen à 175 W,
ein Wechselrichter mit Nennleistung 20 kW AC - 156 m2 Gesamt-Modulfläche
- 448 m ü.M., Schrägdach-Anlage
- 5° Südabweichung, leicht nach West orientiert
- 20° Neigung
- Spezieller Unterhalt/Instandhaltung
Jahr 2021: Wechselrichterausfall; Leistungselektronik (IGBT) repariert/ersetzt